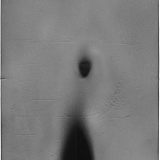Heiko Neumeister
Selbstbehauptung im Angesicht des Absoluten
Rückstichheftung
34 Seiten
ISBN: 978-3-86485-017-2
Preis: 12 Euro
bestellen unter: versand(at)textem.de
“Selbstbehauptung im Angesicht des Absoluten.”
So lautet der Titel des Künstlerbuchs von Heiko Neumeister, wobei das Wort “Absoluten” im Titel sonderbar getrennt ist.
Das Buch ist etwa so groß wie eine LP, jedenfalls quadratisch. Das aufgeschlagene Buch liegt eben darum sehr breit vor einem. Breit genug für einen schmalen Weg. Zu betrachten sind Fotografien von Heiko Neumeister, der für dieses Buch Wege- und Straßenarbeiten einer norddeutschen Kleinstadt fotografierte. Unwesentlich, um welche Kleinstadt es sich handelt, sicher nur, dass die Kommune gerade sehr viel Geld in rotes Pflaster investiert, wahrscheinlich um den Erholungseffekt oder jedenfalls die Attraktivität der Straße zu steigern.
Wichtig ist bei den Aufnahmen die Fokussierung auf die geometrische Exzentrik der Brezelwege, die hier entstehen, die Akribie der Verarbeitung, die Art und Weise, die Manie, mit der im schrägen Nachmittagslicht die Schlagschnur gehandhabt wird. Neumeister, der auch für das Layout des Buchs zeichnet, wählte, begleitend zum konstruktivistischen Sujet eine ebensolche Typografie der 20er, 30er Jahre. Ein schwarzer Balken verläuft durch das ganze Buch, der durchaus rücksichtslos Textelemente verschlingt, so ist der Name des Autors angegriffen, auch der Titel wird, wie oben schon erwähnt, durch eben diese Linie leicht arrogant zur Trennung gezwungen – eine herrische Leitlinie, der sich die Abbildungen allerdings nicht fügen, nur die Seitenzahlen flattern und springen hysterisch (man könnte dieses Buch auch als lehrreiche Warnung an angehende Grafiker verteilen). Die Fotos pflegen ihre eigenen Korrespondenzen untereinander, fette rote Backsteine nehmen bildübergreifend rechte Winkel und orange leuchtende Rautenformationen an. Die einzelnen Bilder sind jeweils so zueinander angeordnet, dass es “passt”, etwa so, wie man geistesabwesend ein Blatt Papier und einen Stift an einer Tischkante ausrichten würde. Neumeister wiederholt damit im Buch die sonderbare Zielstrebigkeit und Perfektion, die man den Pflasterwegen selbst attestieren kann: Eine Bizarrie, die sehr viel Sorgfalt und im Fall der Pflasterarbeiten ausdauerndes Knien verlangt und überall in Deutschland zu finden ist. (Nora Sdun)